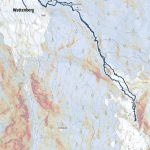Mit dem Anstieg vom Wattenberg verbindet die Schitour auf die Rote Wand dasselbe Ziel als vom Kolsassberg. Beide Touren erfordern nur sehr kurze Anfahrten aus dem Inntal und stellen deshalb leicht erreichbare, schnelle Ziele dar. Die Variante vom Wattenberg ist etwas länger und beträgt um 150Hm weniger – somit besteht etwa derselbe Zeitbedarf.
Der Vorzug auf der Wattener Seite mag für jene, die eher flache Aufstiege und viel Wald bevorzugen, darin gegeben sein. Nachteil beider Schitouren besteht in wenig vorhandenen Parkmöglichkeiten am Ausgangspunkt, wobei am Wattenberg mehr Flächen zur Verfügung stehen.
Der Ausgangspunkt unserer Tour am Wattenberg befindet sich beim Wildstättlift (1.210m), oder 320m weiter oberhalb auf der Gemeindestraße, bei einem kleinen Parkplatz des Liftes (1.235m, eigentlich ein Umkehrplatz). In unserem Fall parkten wir dort und trugen die Ausrüstung zum Lift hinab, an dem sich noch genügend Schnee befand, um dort ohne weitere Tragestrecke bis zum Waldrand starten zu können. Zwei weitere Parkmöglichkeiten bestehen unterhalb des Liftes beim „Oberfelderhof“ oder am Rodlerparkplatz „Petern“ etwas weiter oberhalb des ersten Parkplatzes, wie später recherchiert.
Die Tour sollte man überlegen generell erst nach der Schließung des Liftes im Frühjahr zu unternehmen, oder unter der Woche am Vormittag (gem. Homepage des Wildstättliftes kein Betrieb1) da man sonst als Tourengeher den Sinn des Parkplatzes missachtet, der für die schifahrende Bevölkerung gedacht ist. Im Hochwinter kann man sie auch von weiter unten am Wattenberg unternehmen.
Der Aufstieg ab der Talstation des Wildstättliftes findet über das Pistengelände statt und endet am Waldrand, Mitte März auf diesem Teil schon unter Sonnenbegleitung.
Jenseits des Wegs an Waldrand entschieden wir direkt im Wald schräg aufwärts weiter anzusteigen, um, knapp unter 200Hm, weiter oben auf den Kreuztaxenweg (auch Rodelbahn) zu gelangen. Hiermit kürzten wir die Strecke etwa ab.
Mitten im Wald trafen wir auf eine ältere Aufstiegsspur und auf Bienenstöcke, die den Winter übertaucht haben und hoffentlich bald wieder aktiv werden würden.
Am Kreuztaxenweg angelangt wurde dieser überquert, der Spur folgend, und weiter auf ein kurzes waldfreies Stück, bevor der Weg abermals erreicht wurde und ihm weitere ca. 100m gefolgt wurde und der Aufstieg bei der Weggabelung rechts am Wildebenweg weiter fortgesetzt wurde. Diese Weggabelung ist Kreuztaxen (1.610m).
Nach der kurzen Strecke (etwa 200m) am Wildebenweg, der rechts liegen gelassen wurde, marschierten wir, leicht zu orientieren, über eine weitgehend freie Fläche im lichten Wald weiter, entlang des Sommerwegs, am „Rote-Wand-Steig“.
Auf diesen Teil der Schitour befindet man sich bereits am langgezogenen Rücken zur Roten Wand und steigt schon länger unter Sonnenbestrahlung durch die lichten Zirben auf, die auf den dichteren Fichtenwald in der Höhe folgen.
Im weiteren Verlauf verschmälert sich der Rücken und der Planklwandweg, der zu einer seismischen Station führt, wird noch viermal überschritten, sofern er durch die Schneelage überhaupt als Weg wahrgenommen wird.
Etwa auf 1.850m erreichten wir am schmalen Buckel eine Stelle, bei der wir auf die Abfahrt hinunterschauen konnten und somit feststellten, daß wir zu hoch waren und geschätzt 20 bis 30Hm absteigen hätten müssen, um von der Flachstelle unten wieder gegen den Hang in freies Gelände aufsteigen zu können. Die Spur der wir folgten zeichnete den Abstieg vor.
Im Bestreben dies zu vermeiden hielten wir uns weiter am Buckel, der sich nach wenigen Minuten recht zum Grat zuspitze und in einer Art Scharte endete.
Über die Scharte westwärts konnten wir gutes Aufstiegsgelände oberhalb der Planklwände erkennen und beschlossen die wenigen aperen Meter zum Kessel unten abzusteigen und den weiteren Buckel eben westlich zu umgehen, anstelle den tieferen Abstieg zu nehmen.
Diese Aktion kostete uns schätzungsweise eine Viertelstunde gegenüber dem Normalweg, aber vielleicht auch weniger, bedenkt man den tieferen Abstieg ostseitig des Buckels. Ein Hauch von Abenteuer erwartete uns nebenbei, denn die steilen Planklwände waren uns bekannt.
Nach der Scharte stiegen wir ohne nennenswerten Höhengewinn weiter auf eine Lichtung zu und nach dieser querten wir die steiler werdende westseitige Flanke leicht abschüssig.
Bei der nächsten Lichtung, die gesamte Strecke innerhalb von kaum 5min ab der Scharte, schnitten wir den steilen Hang an und stiegen in ein paar Spitzkehren nach oben auf das bereits wieder flacher werdende Buckelplateau (in AV-Karte mit 1.972m bezeichnet) hin.
Der gesamte Umweg war in kaum 15min erledigt und führte uns über einen abwechslungsreichen Teil mit großen Steinblöcken. Den letzten Teil erstiegen wir völlig intuitiv zum Buckel hin über das steile Gelände im Wald und hätten dieses womöglich auf flacherer Partie umgehen können.

zuletzt ein steiler Aufstieg, der in die sonst recht gemütliche Tour ein bisschen Pfiff gebracht hat
Ab der Flachstelle geht der ausgeprägte Buckel in Hanggelände über und wir mußten nur noch zur Spur des Normalaufstiegs in östliche Richtung queren, um weiter am steiler werdenden Hang aufzusteigen.
Durch eine leichte Mulde zwischen fantastischer Zirbenlandschaft steigt man über die letzte Steilstufe auf. Das Gelände ist abwechslungsreich kupiert und es endet auf einem rippenartigen Felsansatz hinter dem nochmals eine kurze Flachstelle den Schlussaufstieg zum Gipfelkreuz der Roten Wand folgt.

nochmals ein Rückblick – aus dem dichten Wald links der Kuppe sind wir herausgetreten; der Normalaufstieg verläuft rechts der Kuppe
An der Kuppe – etwa knapp über 2.100m – kam das Gipfelkreuz ins Visier und die letzten 100Hm Aufstieg über wieder etwas flacheres und baumloses Gelände lag vor uns. Gegen Ende dieses restlichen Aufstiegs treffen die Anstiege von Kolsassberg und Wattenberg zusammen.
Das Gipfelkreuz der Roten Wand steht nicht auf dem Gipfel selber sondern auf dem Rücken davor. Daher ist die Schitour auf die Rote Wand auch nicht mit der Höhe des Gipfels (2.253m) sondern mit der Höhe des Gipfelkreuzes, auf 2.217m angegeben.
Unser Rastpunkt war nicht am Gipfelkreuz geplant, wir wollten versuchen über den Kamm weiter zum Poferer Jöchl zu kommen. Also ließen wir in ungewohnter Manier das Gipfelkreuz einmal links liegen und stiegen durch eine kurze Mulde weiter, links von uns zum Schluß der geodätische Gipfel der Roten Wand, den wir aber nicht beschritten.
Am Ende der kurzen Mulde was unser Vorhaben schlagartig beendet, indem ein steiler Abbruch zu einer Scharte das Vorhaben jäh stoppte. Nach Einschätzung der Situation hätten wir westseitig zwei drei Dutzend Meter tiefer eine leichte Möglichkeit der Umgehung der Scharte gehabt.
Mit der wenig ersprießlichen Situation bei der Rückkehr dort auffellen zu müssen und gegebenenfalls auf der weiteren Strecke wiederholt, ließen wir von dem Vorhaben ab und richteten uns im tiefen Schnee einen Jausenplatz ein, das über eine knappe dreiviertel Stunde in völliger Abgeschiedenheit von anderen Tourengeher genutzt wurde.
Nach Norden ins Karwendel geschaut bietet sich ein bäriger Blick der auslaufenden Gleirsch-Halltal-Kette und auch auf den östlichen Teil der Karwendelhauptkette, die mit der Grubenkarspitze eine sagenhafte Schitour im Frühjahr bietet.
Die Abfahrt von der Roten Wand besteht im oberen Teil übergeordnet aus einer Hangquerung bei der wir versuchten die Hänge in direkter Fallrichtung zu nutzen. Die leichte Harschoberfläche trübte das Vergnügen dabei ein wenig.
Der obere Teil der Abfahrt durch die vereinzelten Zirben erwies sich in Summe aber doch recht vergnüglich. Durch dichteren Wald fährt man dann etwas weiter unten, etwa oberhalb der Stelle, an der wir von der westseitigen Umgehung des Buckels auf die Ostseite zurückgekehrt sind.
Am unteren Teil dieser Abfahrt wird die Flachstelle erreicht zu der wir im Aufstieg nicht mehr abfahren wollten und deshalb die Umgehung wählten. Diese kurze Strecke erwies sich als Schiebestrecke bis zum Aufstiegsrücken, der wieder über angenehmes Gefälle zu befahren war.
Die weitere Abfahrt war geprägt von – je tiefer wir kamen – ziemlich feuchtem, sulzigem Schnee durch die Sonneneinstrahlung auf freien Flächen und fast Lockerschneeverhältnissen in dichterem Wald. Vor und ab Kreuztaxen trafen wir auch Firnverhältnisse an.
Der letzte Hang nach dem Wald, die eigentlich Schipiste zeigte sich in perfektem Firn, den wir abschließend gerne genossen.
Knapp vier Stunden haben wir für die gesamte Tour benötigt, eine halbe Stunde am Gipfelkreuz eingeschlossen. Leider schließt das Panoramahüttl mit dem Lift und somit konnten wir an dem traumhaften Nachmittag dort nicht einkehren.
Dies war dann dafür aber am Weg ins Tal weiter unten im empfehlenswerten Gasthaus Mühle möglich.
Wir haben für die schöne Schitour auf die Rote Wand 4:50 Stunden benötigt, incl. Umgehung oberhalb der Planklwände und etwa 45min am Rastplatz. Die Strecke beträgt 4,3km und 1.010Hm sind zu bewältigen.
Mils, 17.03.2019
1 Stand Homepage Wildstättlift am 04.04.2020 (der Bericht wurde ein Jahr später verfasst)
- Start bei tollem Wetter am Wildstättlift
- Wattental – im Vordergrund das Panoramahüttl
- Querung Weg oberhalb Schipiste am Waldrand
- mitten im Wald am Weg nach Kreuztaxen
- auf eine Aufstiegsspur getroffen
- Freifläche unterhalb Kreuztaxen
- kurzes Stück am Weg
- Wildebenweg – nach der Abzweigung bei Kreuztaxen
- am Rote-Wand-Steig oberhalb Kreuztaxen
- entlang des Rote-Wand-Steiges am Rücken entlang
- Abfahrtsgelände unterhalb; wir hätten absteigen müssen und haben nach Alternativen gesucht
- also die sich zuspitzende Rippe hinauf
- und ein Schlupfloch mit spannender Erwartung der weiteren Entwicklung gefunden
- zunächst fünf Meter hinab
- Rückblick
- was passiert nun, erwartungsvoll geradeaus auf eine Lichtung hinter der Baumgruppe zugesteuert
- interessantes Gelände oberhalb der Planklwände
- zuletzt ein steiler Aufstieg, der in die sonst recht gemütliche Tour ein bisschen Pfiff gebracht hat
- am Plateau angekommen, dem Ausstieg nahe
- westlich des Normalweges aus den Wald getreten, nun ca.zweihundert Meter nach Osten gequert
- Rückblick – am bergseitigen Ende der Kuppe sind wir aus dem Wald herausgekommen
- etwas steileres Gelände in der Folge
- herrliche Passagen zwischen vereinzelten Zirben
- und nochmals eine kurze steilere Partie
- bestes Tourengelände in beruhigender Naturkulisse
- nochmals ein Rückblick – aus dem dichten Wald links der Kuppe sind wir herausgetreten; der Normalaufstieg verläuft rechts der Kuppe
- phantastisches Schigelände
- kleine Kuppe im Rückblick
- weiter in malerischer Kulisse
- Ankunft am Gipfelgelände, etwa 2.100m
- Rückblick auf die Kuppe bei etwa 2.100m
- Rückblick vom Gipfel auf die letzen flacheren 100m Aufstieg
- Evi am Gipfelkreuz der Roten Wand
- Gipfelkreuz Rote Wand, 2.217m
- weiters Kammgelände Richtung Poferer Jöchl
- kurzes Tal rechte (westlich) neben dem geodätischen Gipfel der Roten Wand
- sieht gangbar aus der Kammverlauf
- leider nur zwei Minuten, bevor ein jäher Abbruch zu einer Scharte den Stopp erzwingt
- Blick nach Norden ins Karwendel; um ein Muggenseckele rechts von der Bildmitte die Grubenkarspitze – eine Wahnsinnsschitour!
- der Autor mit frühjahrsfarbenem Gesicht, rechts dahinter die Grubenkarspitze
- Stefans Überredungsversuch eine Halfpipe einzuweihen
- dem Inntal so nah…
- Abfahrt am Gipfelhang, zunächst eher nach Nordost als nach Nord
- Hang nach Nord muß angesteuert werden,um wieder auf den Rücken Richtung Wattenberg zu kommen
- ein paar schöne Schwünge gehen sich trotz harschiger Schneeoberfläche aus
- und Evi
- zurück im Wald – links ist der Buckel den wir westseitig umgangen sind
- Flachstrecke = Schiebestrecke, aber nur ein kurzes Stück
- firnige Schneeverhältnisse unterhalb Kreuztaxen
- nachmittäglicher anregender Blick in die Tiefe des Wattentals
- der letzte Hang am Wildstättlift
- mit bestem Zischfirn
- Übersicht Schitour Rote Wand vom Wattenberg