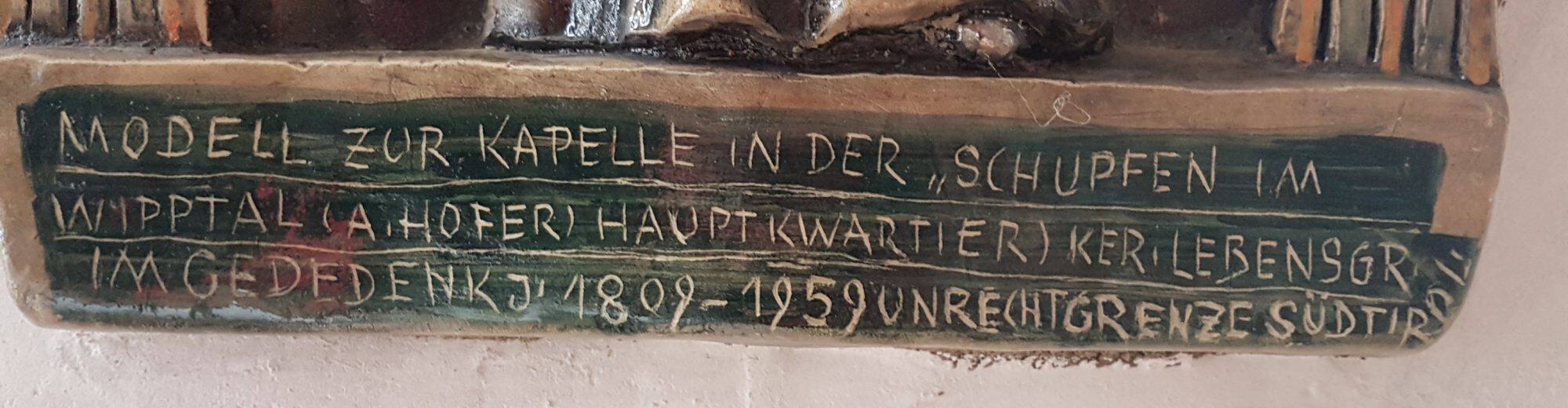Liebe Leser,
leider nichts Neues, die Jahreszeit eignet sich – trotz des perfekten Wetters – nicht wirklich für noch nicht beschriebene Touren, die Tage sind zu kurz und oberhalb von 2.000m muss immer mit Eis am Grat gerechnet werden, ganz sicher auf der Nordseite jeden Grates.
Also begnügen wir uns derzeit mit der multiplen Besteigung des Zunterkopfes, um ein wenig im Training zu bleiben.
Für heut jedoch habe ich mir das Ziel des Großen Bettelwurfes gesetzt und diesen in schlappen 3:45 erreicht.
Vorweg sei gesagt, daß ich die Eisen umsonst hinaufgeschleppt habe, sie sind nicht notwendig. In den harten Schneefeldern wurde gut gespurt und eigentlich ist es von der Abzweigung am Weg zur BW-Hütte bis zum Eisengatterergrat fast rutschiger als oberhalb, dort wo man es erwarten würde.
Die Südhänge bei uns zulande sind derzeit eine Wucht was die Temperatur anbelangt. So konnte ich mich ab dem Sonnenaufgang (derzeit ca. 10min nach der Katzenleiter bei Start um 8 Uhr am Hackl) bis zum Gipfel in nur einem langärmeligen Shirt bewegen, die 20min ab der Abzweigung bis zum Eisengatterergrat ausgenommen, wo der fehlende Bewuchs Thermik entstehen ließ und der sehr spitze Winkel der Sonne um Gelände keine ausreichende Erwärmung zustande brachte.
Ab dem Stöckedepot (ca. 2.300m) besteht innerhalb der Rinne durchwegs griffiger Schnee und an Kuppen und Abbrüchen Eisbildung, jedoch ungefährlich, wenn man etwas aufpaßt. Eisen wären eher hinderlich.
Kurz vor dem Gipfel gehe ich immer nur rechts weg, um unterhalb des trigonometrischen Punktes aufzusteigen. Diese Route war nicht gespurt, jetzt ist sie es, jedoch ist dort so wenig Schnee, daß es auf ein paar geschlagene Tritte nicht ankommt, man steht fast durchwegs am Fels.
Am Gipfel kein Lüftl, Wolken auf der gesamten Rundumsicht nicht auszumachen und warm genug um im sommerlichen Windstopper wieder abzusteigen.
Das Gipfelbuch verrät, daß in den Weihnachtsferien doch einige Bergsteiger am Gipfel waren. Kein Wunder bei den guten Bedingungen für diesen Gipfel.
Sicht weit über 100km, von den fernen Lechtalern bis zum Glockner, die fehlende Gesamtfeuchtemenge in der kalten Luft macht’s möglich.
Allen wäre wahrscheinlich lieber, wenn die Schneelage eine Besteigung des Großen Bettelwurfes gar nicht zulassen würde, aber wir müssen uns damit abfinden, daß die Tourenschi noch länger im Keller warten müssen. Ein Traumtag wie der heutige entschädigt aber vollauf und man lasse die Bilder wirken!
Berg Heil und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017!
Rainer
31. Dezember 2016
- das Ziel nach 8 Uhr im Morgenlicht beleuchtet
- Sonnenaufgang Ende Dezember 2016 auf ca. 1.450m
- die Bettelwurfhütte schläft über dem Halltal
- Halltal zu Sylvester
- Beginn Eisengatterergrat
- Anstieg vom Eisengatterergrat aus gesehen
- Das Gipelkreuz der Hohen Fürleg im Osten
- Stöckedepot
- Das Gipelkreuz des Kleinen Bettelwurf im Westen
- Aufstieg kurz nach dem Stöckedepot
- Passage innerhalb der Rinne
- 150m unterhalb des Gipfels
- innerhalb der Rinne
- am Gipfel des Großen Bettelwurfes am 31. Dezember 2016
- Großer Bettelwurf, 2.726m am 31.12.2016
- Selbstbildnis des Autors
- Karwendelhauptkette mit Ausläufer in den Halleranger
- die höchsten der Karwendelhauptkette
- Blick bis weit ins Lechtal
- Glocknergruppe vom Großen Bettelwurf aus gesehen 31.12.2016
- Grat zum Bettelwurf Osteck
- schneeloses Inntal und Stubaier im Hintergrund
- Fallbachkartürme vom Großen Bettelwurf aus gesehen 31.12.2016
- am Abstieg ins noch lange dunkle Halltal geblickt